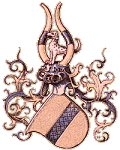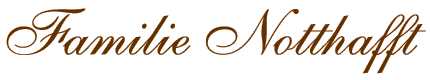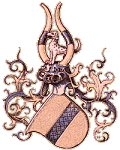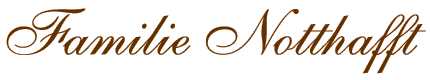Ein Besuch in Wildstein 1993
Am 22. Juni 1993 stand anläßlich eines Besuches von Freifrau Maria Therese
Notthafft von Weißenstein in Kulmbach auch eine Besichtigung von Wildstein auf
dem Programm. Gegen 10 Uhr trafen wir, Frau v. Notthafft, Herr Dr. Hartmann
Frhr. v. Bechtolsheim, dessen Gemahlin und ich, mit Herrn Franz Schmitzer aus
Lorenzreuth zusammen. Herr Schmitzer, ein gebürtiger Wildsteiner, hatte sich
dazu bereit erklärt uns zu führen.
Den Eingang in den Bereich der Vorburg vermittelt eine ehemals von
Kreuzgratgewölben überdeckte Torgasse, welche durch das wohl aus Trautenberger
Zeit stammende neue Schloßgebäude führt. In diesem war bis zur Vertreibung das
Gericht samt Gefängnisräumen untergebracht. Wohl noch bis in die 60er Jahre war
das Gebäude mit einem Mansardendach versehen. Heute ist es eine Ruine. Den
ältesten Teil dieser "Vorburg" bildet das als Risalit aus dem Schloßbau
hervortretende äußere Torgebäude, das im Erdgeschoßbereich aus bossierten
Quadersteinen aufgeführt ist. Auch das Gewände des Torbogens selbst, weist auf
eine Entstehung in romanischer Zeit.
Am "Höllenhund", einem sehr kleinen aber auch sehr angriffslustigen Vierbeiner
- er hat schon einmal Dr. Friedrich Wilhelm Singer aus Arzberg in die Ferse zu
beißen versucht! - vorbei, ging es dann zur Hauptburg, deren Tür uns die
Kulturdezernentin der Gemeinde Wildstein öffnete. Wie Herr Schmitzer darlegte,
ist der heutige Zugang erst spät entstanden. Ursprünglich war die Burg durch
ein Torgebäude südlich des Bergfrieds zu betreten. Der heutige Eingang wurde
wohl erst im 19. Jahrhundert durch die Apsis der Burgkapelle gebrochen, als die
alte Burg zum Malzhaus umgebaut wurde. Es handelte sich um eine wohl einst
flachgedeckte Stufenkapelle, in welcher die Herrschaft in einem erhöhten Raum
gegenüber der Apsis Platz hatte, während die anderen Gottesdienstbesucher
niedriger, direkt vor dem Altarraum saßen. Neben dem Kapellenbau und dem
genannten Bergfried, dessen Außenmauern ebenfalls Buckelquader aufweisen, zählt
noch das erwähnte Torgebäude, sowie das zwischen Torgebäude und Kapelle
errichtete "steinerne Haus", das als ursprünglich alleiniges Palasgebäude
allerdings zu klein erscheint, zu den ältesten Bauteilen der Burg.
Wahrscheinlich waren noch die Räume im Obergeschoß des Torhauses zu Wohnzwecken
genutzt. Der übrige Raum der Felsklippe war mit einer Wehrmauer umfriedet, die
eine geringere Dicke als die höheren ursprünglichen Wohnbauten aufweist.
Später, wohl im 13. Jahrhundert, wurde dann auf der Nordwestseite der
Felsklippe, gegenüber von Kapelle und dem "steineren Haus" ein gotisches
Palasgebäude errichtet, das im Erdgeschoß noch sehr imposante Gewölbe aufweist.
Der übrig gebliebene Lichtraum wurde erst später überbaut. Der sich südlich an
den gotischen Palasbau anschließende, im Osten vom Torgebäude begrenzte Raum,
weist ein Kappengewölbe mit Gurtbögen auf, das wahrscheinlich erst aus dem 17.
Jahrhundert, oder noch späterer Zeit stammt.
Das Kellergeschoß war uns leider nicht zugänglich. Der Grundriß der Burg zeigt
jedoch, daß nur die ältesten, aus romanischer Zeit stammenden Gebäudeteile
unterkellert sind. Der sich bis unter den Bergfried hinziehende, östlichste
Kellerraum, stammt aus jüngerer Zeit und wurde als Bierkeller genutzt. Ebenso
wurde von Norden her ein heute wieder vermauerter Zugang zu den alten Kellern
des Burggebäudes in jüngerer Zeit gebrochen.
Das zum Teil bereits beschriebene Erdgeschoß weist überwiegend Kreuzgratgewölbe
auf. Das "steinerne Haus", das etwa eine halbe Geschoßhöhe höher liegt, als die
übrigen Bauteile der Hochburg, ist - ebenso wie das südlich daran anschließende
Torgebäude - im Erdgeschoßbereich tonnengewölbt. Im südwestlichsten Raum des
Erdgeschosses mit dem bereits beschriebenen Kappengewölbe wurde ein
Stützpfeiler angebracht. Hier befindet sich insgesamt die gefährdetste Stelle
des alten Burggebäudes, da die relativ dünne Wehrmauer des Lichthofes ohne
Verstärkung bis in das 2. Geschoß hochgezogen wurde und dieser Mauerabschnitt
seiner statischen Belastung nicht gewachsen ist. Diese Schwachstelle soll durch
einen Betonkranz im Bereich der Dachschwelle gesichert werden.
Die Decken des ersten und zweiten Obergeschosses fehlen. Nur noch die
Unterzugbalken, die zum Teil schöne Profilierungen tragen, erinnern noch an die
ehemals hier vorhandenen Balkeneinschubdecken. Diese stammen - den Profilen der
Unterzugbalken nach zu urteilen, warscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, ebenso
wie wohl auch der Dachstuhl des Gebäudes. Das 1. Obergeschoß weist zahlreiche
Mauerrisse auf. Mehrere vor etwa 5 Jahren angebrachte Gipsbrücken schließen
jedoch jüngere Mauerbewegungen aus. Wenn sich die Sicherungsarbeiten jedoch
noch länger hinauszögern, wird der Bestand vor allem des südwestlichsten
Gebäudeteils allerdings akut gefährdet. Das 2. Obergeschoß war, bedingt durch
die fehlenden Fußböden, nicht zu betreten.
Nach dem Mittagessen stieß der Wildsteiner Bürgermeister, Herr Prochatzka zu
uns. Er berichtete, daß eine Schweizer Firma in Wildstein einen Golfplatz mit
Hotel etc. errichten möchte, und daß dabei wohl auch eine Sanierung der alten
Burg möglich wäre. Der Tag endete mit einem Besuch im Amtszimmer des
Bürgermeisters und mit einer kurzen Visite in der Wildsteiner Kirche. Es ist zu
hoffen, daß die Pläne des Bürgermeisters Früchte tragen werden, nicht nur für
die Erhaltung der alten Burg, sondern vor allem für die Bevölkerung seines
Ortes.
Harald Stark
|
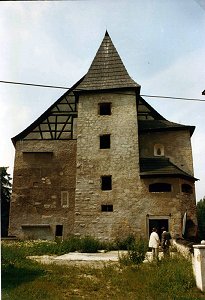
|
|
Die Ostseite der Kernburg mit dem Bergfried und dem heutigen Eingangsportal
|
|